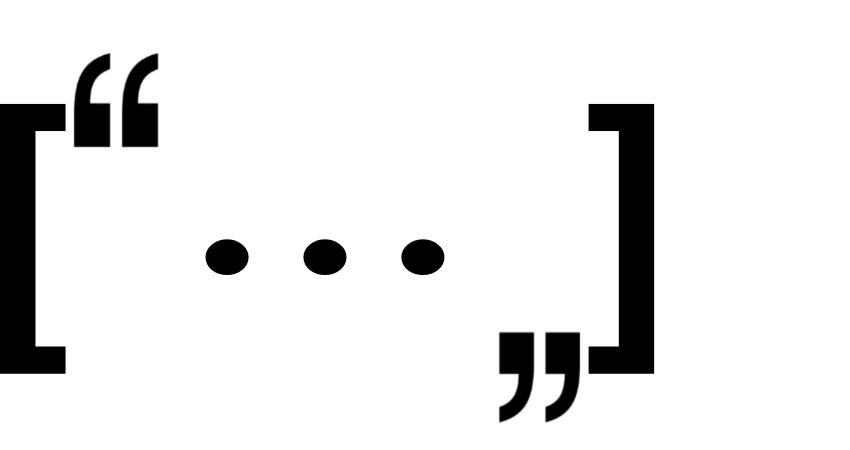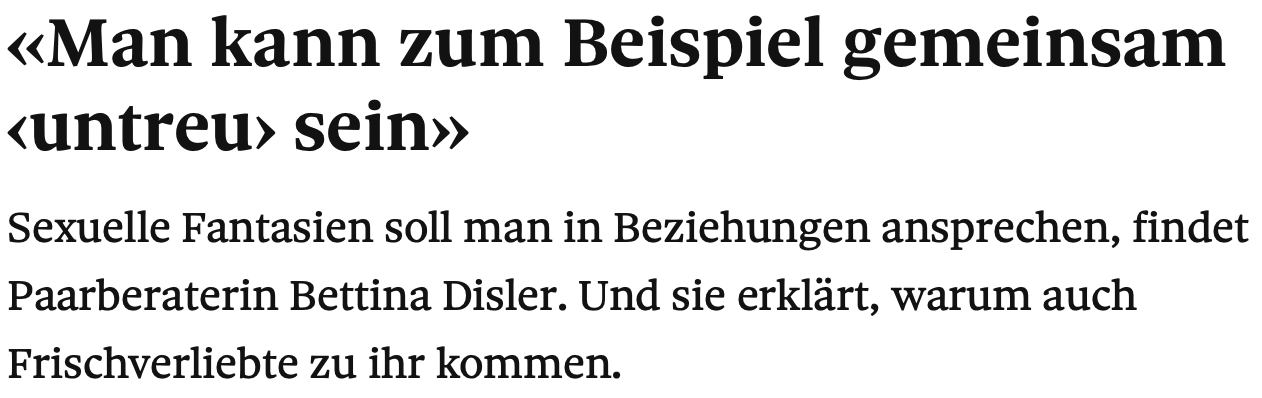Ein Gespräch mit Dr. Gabi Landmann, Gynäkologin mit eigener Praxis in Küsnacht und Bettina Disler, Paartherapeutin und Sexualberaterin
AUS DER INTERVIEWREIHE MED TALK IN „LOVE, SEX & SCIENCE“ VON BETTINA DISLER
Lichen sclerosus ist ein Begriff, der vielen Frauen lange nicht begegnet, obschon sie seit Jahren ein anhaltendes Unwohlsein im Intimbereich und Schmerzen beim Sex haben. In meiner Praxis begegne ich regelmässig Frauen, die sich durch verschiedenste Behandlungen bewegen, ohne klare Diagnose und oft begleitet von Selbstzweifeln, Rückzug aus der Sexualität und dem Gefühl, mit ihren Beschwerden allein zu sein.
Umso wertvoller ist der fachliche Einblick, den uns Dr. Gabi Landmann in diesem Interview gewährt. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und teilt ihr Wissen zu typischen Symptomen, diagnostischen Herausforderungen und evidenzbasierten Behandlungsmöglichkeiten bei Lichen sclerosus.
Welche typischen Symptome und klinischen Befunde deuten aus gynäkologischer Sicht frühzeitig auf Lichen sclerosus hin?
Dr. Gabi Landmann: Leitsymptom ist ein starker Juckreiz an der Vulva, oft begleitet von Brennen oder Schmerzen, besonders bei Reibung (z. B. beim Geschlechtsverkehr oder durch enge Kleidung). Harndrang oder Brennen beim Wasserlösen ohne Nachweis eines Infekts können ebenfalls darauf hinweisen. Anfangs können sichtbare Hautveränderungen fehlen. Typisch sind jedoch kleine Hautrisse (Rhagaden), weißliche Hautareale (Keratose), trockene, rauhe Hautflecken (Lichenifikation) und narbige Veränderungen (Sklerose). Die chronische Entzündung kann zu anatomischen Veränderungen führen, etwa Klitorisphimose, Verklebung der Schamlippen oder einer Verengung des Scheideneingangs, was Schmerzen verursachen kann.
Welche Risikofaktoren begünstigen nach aktuellem Stand der Forschung die Entstehung von Lichen sclerosus?
Dr. Gabi Landmann: Lichen sclerosus ist eine Autoimmunerkrankung, deren genaue Auslöser unklar sind. Diskutiert, aber wissenschaftlich nicht eindeutig belegt, werden Infekte, Verletzungen oder Medikamente als mögliche Trigger. Ob die hormonelle Situation (präpubertär, prämenopausal, postmenopausal) der Frau eine Rolle spielt, ist bis heute nicht geklärt. Eine genetische Komponente wird vermutet, da 5–10 % der Patientinnen von betroffenen Verwandten berichten. Häufig bestehen bei Betroffenen weitere Autoimmunerkrankungen, wobei die autoimmune Schilddrüsenunterfunktion (Hashimoto) die am häufigsten assoziierte Erkrankung ist.
Welche Fehlinformationen und Ängste begegnen Ihnen in der Praxis besonders häufig?
Dr. Gabi Landmann: Die verbreitetste „Fehlinformation“ ist die Unkenntnis der Erkrankung selbst bei Betroffenen, aber auch bei Ärzt:innen. Oft werden die Beschwerden wiederholt als Pilzinfektion behandelt. Zudem besteht Unsicherheit im Umgang mit der empfohlenen lokalen Kortisontherapie und viele setzen diese aus Angst vor Nebenwirkungen zu früh ab. Eine korrekt dosierte, langfristige Anwendung ist jedoch entscheidend für den langanhaltenden Therapieerfolg.
Grosse Ängste bestehen auch davor, dass der Scheideneingang zusammenwachsen könnte. Das ist allerdings eine sehr seltene Komplikation, die sich, wenn überhaupt, über Jahre hinweg ausbildet. Unter regelmässiger, fachärztlicher Betreuung und konsequenter lokaler Therapie ist ein Fortschreiten der Krankheit in diesem Ausmass sehr unwahrscheinlich. Nicht ganz zu unrecht besteht zudem die Angst vor einem Vulvakarzinom: Lichen Sclerosus ist ein Risikofaktor für die Entstehung eines Vulvakarzinoms, allerdings erkranken nur etwa 3 bis 5 % der Betroffenen daran. Zur Verhinderung und Früherkennung eines Vulvakarzinoms sind auch hier regelmässige Kontrollen und eine konsequente Therapie wichtig.
Wie häufig tritt Lichen sclerosus bei Männern auf, und welche Unterschiede zeigen sich in Diagnostik, Lokalisation und Verlauf im Vergleich zu Frauen?
Dr. Gabi Landmann: Männer sind deutlich seltener betroffen als Frauen. Am häufigsten zeigt sich die Erkrankung durch eine Vorhautverengung (Phimose). Männer, die im Säuglingsalter beschnitten wurden, scheinen ein geringeres Risiko zu haben, einen Lichen sclerosus zu entwickeln. Da ich als Frauenärztin keine Männer behandle, bin ich mit der Diagnostik und Behandlung der Krankheit bei Männern allerdings nicht sehr vertraut.
Welche evidenzbasierten medizinischen Behandlungsansätze helfen Patient:innen dabei, trotz Lichen sclerosus eine schmerzfreie Sexualität zu erleben?
Dr. Gabi Landmann: Standard ist die lokale Therapie mit hochpotenten Steroidsalben kombiniert mit täglicher Pflege durch rückfettende Emollientien. Initial wird über mehrere Wochen täglich ganz sparsam Kortsionsalbe aufgetragen um die Entzündung zu hemmen. Im Verlauf wird langfristig in eine sogenannte Erhaltungstherapie übergegangen mit ein bis zwei Applikationen pro Woche. Alternativ oder zusätzlich zu den lokalen Steroiden können als Zweitlinientherapie auch topische Calcineurininhibitoren (Tacrolimus) eingesetzt werden, um die chronische Entzündung einzudämmen.
Andere Verfahren (Laser, PRP, UV-Licht-Exposition und lokale Retinoide) befinden sich noch in klinischer Prüfung. Topische Hormone, insbesondere Testosteron, haben sich als wirkungslos erwiesen und sollten nicht angewendet werden. Auch Trigger, wie das Tragen von enger Kleidung, benutzen von Feuchttüchern, übermässig häufiges Waschen, oder unnötige Verletzung wie beispielsweise durch Piercings sollten vermieden werden.
Schmerzen bei Geschlechtsverkehr sind bei Lichen sclerosus nicht obligat. Durch die Behandlung der Entzündung mit lokalen Steroiden wird die Haut oft wieder weitgehend normalisiert, vorausgesetzt, dass nicht schon eine starke Narbenbildung/Sklerose der Haut eingesetzt hat. Zudem kann die Verwendung eines Gleitmittels helfen, die Reibung der Haut und somit die Aktivierung der Entzündung zu mindern.
Welche Therapieformen stehen aktuell zur Verfügung, und wie unterscheiden sich konservative und chirurgische Ansätze?
Dr. Gabi Landmann: Die konservative Behandlung mit Kortison und Pflege steht im Vordergrund. In wenigen Fällen ist ein chirurgischer Eingriff erforderlich. Die Indikation zu einer Operation sollte aber zurückhaltend und sehr sorgfältig gestellt werden. Nach einer Operation muss eine intensive Nachbehandlung und engmaschige Betreuung erfolgen, um zu verhindern, dass die gelösten Strukturen kurz nach der Operationen wieder zusammenwachsen. Die Operation birgt auch das Risiko einer Aktivierung und Verschlechterung der Erkrankung. Dies ist auch der Grund, warum eine Hautprobe (Biopsie) nicht standardmässig erfolgen soll, um die Diagnose zu stellen.
THERAPEUTISCHE PERSPEKTIVE BEI LICHEN SCLEROSUS: KÖRPERWAHRNEHMUNG, SEXUALITÄT UND PARTNERSCHAFT
Die Ausführungen von Dr. Gabi Landmann verdeutlichen eindrucksvoll, wie essenziell eine frühzeitige, fundierte Diagnose und leitliniengerechte Behandlung bei Lichen sclerosus sind. In meiner Arbeit als Paartherapeutin und Sexualberaterin zeigt sich zugleich, wie stark die Erkrankung das körperliche Selbstempfinden, die sexuelle Identität und das partnerschaftliche Miteinander prägen kann.
Viele betroffene Frauen berichten von einem zunehmenden Gefühl der Entfremdung vom eigenen Körper. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, die Angst vor Verletzungen oder die Sorge, in der Partnerschaft nicht mehr „funktionieren“ zu können, führen häufig zu Rückzug, emotionaler Distanz und Unsicherheiten in der Kommunikation. Der Weg zur Diagnose ist oftmals lang, begleitet von Frustration, Fehldeutungen und einem zunehmenden Verlust von Vertrauen in den eigenen Körper.
Eine differenzierte medizinische Versorgung bildet daher die unverzichtbare Grundlage zur Symptomkontrolle und die Basis für eine gelingende psychosexuelle Verarbeitung. In vielen Fällen braucht es darüber hinaus Raum für offene Gespräche über veränderte Lust, neue Formen der Intimität, über Grenzen, Scham und das Wiederentdecken körperlicher Nähe. Gerade wenn strukturelle Veränderungen oder belastende Vorerfahrungen die Sexualität prägen, kann eine sexual- oder paartherapeutische Begleitung helfen, das eigene Erleben neu zu ordnen und tragfähige Wege zu mehr Vertrauen, Verbundenheit und sexueller Selbstbestimmung zu entwickeln.